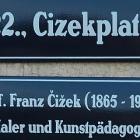Schulen werden geschlossen
Mit dem Heranrücken der russischen Truppen werden im Februar 1945 sämtliche Schulen geschlossen und die Kinder evakuiert. Lange Flüchtlingsströme volksdeutscher Familien ziehen mit ihren Pferdewagen aus dem Banat und der Batschka herauf, einige von ihnen bleiben auf ihrem Durchzug in Hirschstetten und finden hier eine zweite Heimat.
Dritter Großangriff
Am 12. März 1945 erfolgt der dritter Großangriff, der wieder den alten Ortskern von Hirschstetten, jedoch auch das Fabriksgelände der Wagner-Biro (mit Russenlager) trift. Wieder werden Bauern- bzw. Wohnhäuser, das Schloss der Familie Pirquet und auch das Postamt, das sich im Personaltrakt des Schlosses auf der Hirschstettnerstraße 87 befindet, durch Bombentreffer zerstört.
Nur das Straßenportal mit dem Wappen an der Hirschstettner Straße, Reste des Eckpavillons, Teile der Gartenmauer und die Schlosskapelle mit dem Altarbild Maria Immaculata aus dem 18. Jahrhundert blieben erhalten.
Auch das kostbare, von Daniel Gran stammende Deckengemälde im Schlosssaal, kann nicht gerettet werden. Der gegenüber dem Schloss liegende Wirtschaftshof des Besitzers Andre wird ebenfalls arg beschädigt.

Stadlauer Eisenbahnbrücke schwer beschädigt
Im Kampf um Wien wird die Brücke schwer beschädigt.
Noch im selben Jahr wurde sie wieder provisorisch in Stand gesetzt.

Verteidigungsbereich Wien
Am 2. April wird Wien zum Verteidigungsbereich erklärt. Frauen und Kinder werden angewiesen die Stadt zu verlassen und in weiter westlichen Gebieten Zuflucht zu suchen. Der letzte Evakuierungszug für die Zivilbevölkerung verlässt am 3. April den Bahnhof Stadlau.
Reichsbrücke nicht gesprengt
Auf Grund der aussichtslosen Situation soll die Reichsbrücke von deutschen Truppen gesprengt werden. Jedoch werden die vorbereiteten Sprengladungen von Widerstandskämpfern beseitigt. Auch die neuerlich angebrachten Sprengladungen werden unschädlich gemacht, so dass in der Nacht zum 13. April von Booten der sowjetischen Donauflotte aus die Brücke besetzt wird.
So bleibt die Reichsbrücke als einzige Donaubrücke zwischen Linz und Budapest erhalten. Sie ist für die Versorgung Wiens und den Beginn des Wiederaufbaus von besonderer Bedeutung.
Kriegsschäden beseitigt - Kriegerheimstätten
Durch den Zusammenhalt und die gemeinsame Anstrengung, konnten sämtliche Kriegsschäden bis 1948 beseitigt werden.
Jeder Siedler leistet, durch einen Beschluss der Generalversammlung (1945) festgelegt, 150 Aufbaustunden.
Neue Siedlung
Bald nach Beendigung des zweiten Weltkrieges wurde mit den Instandsetzungsarbeiten und mit dem Bau von Wohnungen begonnen. Die Wohnungsnot war unvorstellbar groß geworden. Am Stadtrand wurden Siedlungsgebiete in aufgelockerter Form mit grüner Umgebung erschlossen.
So entstand im Rahmen der sozialen Wohnbautätigkeit der Gemeinde Wien im im Bereich Maschlgasse eine der größten Siedlungsanlagen der Nachkriegszeit.
Im Rahmen der Gundsteinlegung sprach der damalige Bürgermeister Wiens, Theodor Körner, folgende Worte: Der Siedlung Friede und Wohlstand, den Kindern Lebensfreude, den Frau und Männern Arbeit und Erfolg, den Alten Ruhe und Geborgenheit, den Generationen in ferner Zukunft Freiheit.
Der von der Arbeitsgemeinschaft der Architekten Omasta, Sammer und Zügner entworfene Bau besteht aus 89 Einfamilien- und 63 Mehrfamilienhäusern mit zusammen 347 Wohnungen. Baukomplex: 104.490 Quadratmeter. An der Vorderfront eines Mehrfamilienhauses bindet sich ein Sgraffito, das den Bauernführer Hans Kudlich (1848) darstellt. Die durchschnittliche Bodenfläche einer Wohnung beträgt 64,1 Quadratmeter. In dem Bestreben, viele Grünflächen zu schaffen, wurden nur 15,4% des Bauareals, das sind 16.244 Quadratmeter, verbaut.
Die Bauzeit dauerte vom 12. April 1948 bis zum 17. April 1950. Die Gesamtkosten betrugen S 27,855.000. Zur Zeit der Eröffnung war die Siedlung von 911 Erwachsenen und 661 Kindern bewohnt
Tabak Trafik Fotter
Diese Tabak Trafik (Lokal A) versorgt die Siedler nicht nnur mit Rauchwaren, sondern mit vielen Kurzwaren, Dingen des täglichen Gebrauchs: Papier, Schreibwaren, Klebstoffe, Brief und Stempelmarken, Glückwunschkarten, Gummiringe, ...
Die Trafik bestand bis in die 1970er Jahre.
Wann wurde sie eröffnet, wann endgültig geschlossen?
Baumschule Schick
Ing. Ferdinand Schick übernimmt die Baumschule Schick.
Während des zweiten Weltkrieges hat auch sie durch die verheerenden Wirkungen der Bombenwürfe großen Schaden genommen, so dass ihre Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigt wurde. Nach dem Weltkrieg konnten die Schäden bald behoben werden.
Müllentsorgung
Obwohl sich das Magistrat von Wien seit gut zwanzig Jahren um die Entsorgung des Hauskehrichtes und Mülls in der Stadt angenommen hat, müssen die Siedler an den Stadträndern die Entsorgung selbst in die Hand nehmen.
Die biogenen Abfälle landen in der Regel am Misthaufen (in der Mistgrube) im Garten, brennbares wird verheizt, jedoch die Asche und anderer Unrat muss entsorgt werden. Dies geschieht, wie vielerorts üblich, durch Wegkippen in Gruben, Löcher oder Terrainvertiefungen zur Planierung.
Die Bewohner der Siedlung Kriegerheimstätten
deponieren den Müll in den Senken neben der Bahn. Die Schotter- und Schwemmsandvorkommen werden für Sanierungsarbeiten abgebaut und die entstandene Grube mit Mist wieder aufgefüllt. Aber nicht nur die Siedler füllen die Senken und Bombentrichter, Fuhrwerksunternehmen bringen Produktionsrückstände, Fässer und Müll jeder Art aus den nahe gelegenen Betrieben. Der Bereich zwischen Aupark und Hausfeld dient als Deponie.
So mancher Siedler entleert seine Aschenkübel, füllt sie mit Sand und Schotter auf und packt noch so manchen Schatz aus der Grube auf seinen Leiterwagen. Zahlreiche Kriegsrelikte und Flugzeugteile erinnern an die letzten Kriegstage. Oft stehen die Gruben in Flammen, um das Volumen zu reduzieren und Platz für neuen Mist zu schaffen.
Auch zahlreiche Sand- und Schottergruben werden am Ende des Abbauarbeiten mit Unrat verfüllt und wieder planiert.
Erstkommunion - Mädchengruppe
Haben Sie sich auch erkannt?
Dann schreiben Sie mir bitte und berichten von damals, vielleicht kommt auch noch ein Klassentreffen zu Stande.
Brigitte, das Mädchen mit den Zöpfen in der 2. Reihe gleich neben der Klosterschwester, hat mir dieses Foto zukommen lassen und wollte mehr Informationen über ihre ehemalige Volksschule.
Die Erstkommunion zelebrieren Pfarrer Johann Ullrich (Kagran) und Kaplan Josef Nußbaumer. Rechts im Bild Schwester Augustina, die durch ihre liebevolle Art noch vielen Generationen in Erinnerung ist.
Kindergartenspaziergang
Bei einem Spaziergang rund um die Neue Siedlung
, die von zahlreichen Feldern umgeben ist, erreichen die Kinder die unbefestigte Straße neben der Ostbahn (heute Guido-Lammer-Gasse / Hans-Lang-Weg).
Der Gemeinde(?)-Kindergarten soll im Bereich Cizekplatz angesiedelt gewesen sein. Angeblich im Erdgeschoßbereich des jetzigen Pensionistenclubs?
Nähere Infos dazu bzw. Fotos sind sehr willkommen!
Baubeginn des Reservegarten Hirschstetten
1952 bis 1960 wird der Reservegarten in Hirschstetten angelegt. Das 24 Hektar umfassende Gelände lässt den jährlichen Anbau von 1 Million Pflanzen zu.
Etwa 4,5 km Betonstraßen schließen das Arbeitsgelände auf. Außer dem Freigelände sind 30 Glashäuser, 4 Glashausblockanlagen, 2 Überwinterungshäuser mit den dazugehörigen Verbindungshäusern und ein großes Palmenhaus entstanden.
Schloss - Relief
1953 gibt Silverio Peter Pirquet die Anfertigung eines Holzmodells des Schlosses samt Gartenanlagen in Auftrag, wie es vor dem Brand ca. 1860 ausgesehen hat. Die Arbeiten werden von Familie Heissl, eine seit Generationen ansässige Schnitzerfamilie in Rindbach N. bei Ebensee, Ober-Österreich ausgeführt.
Das gut erhaltene Modell befindet sich im Bezirksmuseum Donaustadt, nachdem es viele Jahre in der Pfarre Hirschstetten nahe der alten Bibliothek zu bewundern war.
Auf der Grundplatte neben der östlichen Gartenmauer befindet sich eine handschriftliche Kurzchronik der Schlossbesitzer.
Neue Straßennamen
Mit der ständigen Entwicklung des sozialen Wohnungsbaues der Stadt Wien sind seit Kriegsende viele neue Straßenzüge entstanden, die nun ihre Namen bekommen. Der Gemeinderatsausschuss für Kultur und Volksbildung benennt dutzende Verkehrsflächen in den neuen Wohnhausanlagen mit Namen bedeutender Persönlichkeiten.
So werden die Gassen der "Neuen Siedlung" wie folgt benannt: eine nach dem österreichischen Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Karl Luick, eine andere nach dem Komponisten Oskar Nedbal. Vier weitere Verkehrsflächen erhalten die Namen des Wiener Gynäkologen Prof. Dr. Josef Späth, des österreichischen Geologen Prof. Dr. Franz Toula, des Wiener Malers Franz Schams und des Nationalrates Josef Tomschik. Die bis jetzt mit den Ziffern 1 und 12 bezeichneten Gassen werden in "Maschlgasse" umbenannt. Rudolf Maschl d.Ä. hat sich als Siedlerobmann große Verdienste erworben, sein Sohn Rudolf ist im Alter von 23 Jahren für die Freiheit Österreichs gestorben. Der Platz im Zentrum der Siedlung wird nach dem Begründer der Jugendkunstbewegung und bedeutenden Kunstgewerbler Franz Cizek benannt.