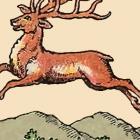Flurbezeichnung - Mittleres Hausfeld
Im Generalstadtplan von Wien sind die ortsüblichen Flurbezeichnungen eingetragen. Diese werden heute noch verwendet und spiegeln sich oft in Straßenbezeichnungen wieder.
Das Mittlere Hausfeld bezeichnet jenen Bereich, der umschlossen wird von der Ostbahnbegleitstraße - (Aspern Nord) Mayrederbrücke verlängert bis Böckingstraße - Pilotengasse - Hausfeldstraße.
Flurbezeichnung - Mittelfeld
Im Generalstadtplan von Wien sind die ortsüblichen Flurbezeichnungen eingetragen. Diese werden heute noch verwendet und spiegeln sich oft in Straßenbezeichnungen wieder.
Das Mittelfeld beschreibt den (geraden) Geländestreifen zwischen Süßenbrunner Straße und Spargelfeldstraße, im Norden begrenzt durch die Stadtgrenze (heutige Reststoffdeponie Rautenweg inklusive) und im Süden durch die Anfanggasse. Etwa 2/3 der Fläche an der Sparelfeldstraße angrenzend zwischen Anfanggasse und Oberfeldgasse wird von der Baumschule Pirquet genutzt.
Flurbezeichnung - Unterfeld
Im Generalstadtplan von Wien sind die ortsüblichen Flurbezeichnungen eingetragen. Diese werden heute noch verwendet und spiegeln sich oft in Straßenbezeichnungen wieder.
Das Unterfeld beschreibt den (geraden) Geländestreifen zwischen Spargelfeldstraße und Ziegelhofstraße (und deren gedachte geradlinige Verlängerung, im Norden begrenzt durch den Rautenweg und im Süden (vermutlich) durch die Aspernstraße (ev. Langobardenstraße?). Dieses Gebiet umfasst somit Schule Contiweg, Wohnhausanlage Quadenstraße 8, Blumengärten (Reservegärten), Fußballplatz, Badeteich und die Stadtrandsiedlung an der Breitenleer Straße.
Wien-Aspern - LZ 17 Sachsen
Im Rahmen des zweiten Internationalen Flugmeetings landet das Luftschiff LZ-17 Sachsen
aus Baden-Oos kommend, nach einer Fahrt von 9 Stunden und 26 Minuten um 14:53 am Flughafen Wien-Aspern.
Die 760 km lange Reiseroute legt der Zeppelin von Baden-Oos über Stuttgart, Ingolstadt, Passau und Linz nach Wien mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 80 km/h zurück und wird mit großem Jubel von der Wiener Bevölkerung empfangen. Kaiser Franz Joseph I. läd den mitgereisten Erfinder und Unternehmer Ferdinand Graf von Zeppelin zu einer Audienz und ein Galadiner nach Schönbrunn ein.

Leere Kriegskassen
Während die Industrie durch die Produktion von Kriegsmaterial noch nie dagewesene Umsätze verzeichnet, muss die Gemeinde Wien aus ihrem Säckel so lange zur Rüstung beisteuern, bis die Stadtkasse leer ist.
Nun werden die Wiener selbst - und unmittelbar - an ihren Patriotismus erinnert. Es komm zur Aktion „Gold geb ich für Eisen“. Jeder Patriot wird aufgefordert, seinen Goldschmuck gegen gleich große Eisenstücke einzutauschen - fürs Vaterland und für den Sieg …
AEG Maschinenhalle
Nahe dem Eisenbahnübergang in der Stadlauer Straße beginnen die Arbeiten zur Errichtung einer Großmaschinenhalle nach den Plänen des Stuttgarter Architekten Philipp Jakob Manz. Die Arbeiten werden durchgeführt von der A. Porr GmbH und der Allgemeinen Österreichischen Baugesellschaft für die A.E.G-Union Elektrizitäts-Gesellschaft.

Eiserne Reserve
Aber trotz aller Aktionen und Anstrengungen brachte der erste Kriegswinter erstmals eine arge Lebensmittelknappheit für die Wiener. Zuletzt versuchte man, alle bislang ungenützten und an der Stadtgrenze gelegenen Gemüseanbauflächen zu aktivieren. Dadurch sollte eine eiserne Reserve geschaffen werden.
Die Preise steigen, das Angebot auf den Wiener Märkten wird geringer, so dass zahlreiche Hausfrauen versuchen direkt bei den Gärtnern einzukaufen.
Die letzten beiden Kriegsjahre brachten mehr Elend und Not nach Wien, als man befürchtet hatte. Die älteren Männer hatten den Heimatschutz übernommen. Frauen und Mädchen pflegten Verwundete, die in Pflege gebracht worden waren.
Wolfrum Spiritus-, Preßhefe- und Likörfabrik
Fritz Wolfrum übernimmt die Spiritus und Presshefefabrik von Ludwig Bramsch in Wien (Stadlauer Straße 64) und baut den Standort zu einer modernen Fabrik aus.
Auch am Wiener Standort wird die berühmte Spezialität Ein Klostergeheimnis produziert.
Das Familienunternehmen Wolfrum hat seinen Ursprung in der Nähe von Dresden:
1847 Gründung der Eckelmann Spiritus-, Presshefe und Likörfabrik in Preßnitz (ab 1876 Schön-Priesen) gemeinsam mit Ludwig Bramsch (durch einen Schreibfehler aus Bramsche)
1869 gründet Ludwig Bramsch in Teplitz seine eigene Likörfabrik und scheidet aus dem Unternehmen aus
1869 Rudolf Eckelmann und Wilhelm Wolfrum führen den Betrieb weiter und expandieren kräftig
1895 entsteht eine Familien-AG
1906 Umwandlung in eine GmbH unter der Leitung von Fritz Wolfrum, ein Enkel des Firmengründers
1912 Übernahme der Bramschen Spiritus-, Presshefe- und Likörfabrik von Ludwig Bramsch in Teplitz-Schönau
Exponate aus dem Inventar des Bezirksmuseum Donaustadt
Schrebergärten als Pacht
August Schina, Simon Zegarczuk und Franz Spandl erfahren von der Existanz des Wiener Kriegerheimstättenfonds und erreichen nach unzähligen, langwierigen Amtswegen, dass einige Grundstücke des Fonds in Hirschstetten der Ortsgruppe des Landesverbandes Wien der Kriegsbeschädigten für ein Jahr zur Errichtung von Schrebergärten überlassen werden.
Colonia-System - Probebetrieb
Der Bevölkerungsanstieg und das Wachstum der Stadt stellt neue Anforderungen an die Entsorgung des Kehrichts. Die Sammlung durch Mistbauern
, mit ihren nur teilweise gedeckten Fuhrwerken, stößt an ihre Grenzen, denn die Staub- und Geruchsbelästigung ist enorm.
Nun wird mit dem vor einem Jahr vom Gemeiderat beschlossenem Probebetrieb für die Kehrichtsammlung nach dem System Colonia
begonnen. Dazu werden spezielle Sammelgefäße sogenannte Coloniakübel
mit Deckel verwendet. Das motorgetriebene Sammelfahrzeug mit Anhänger ist so konstruiert, dass es durch den hermetischen Abschluss zu keiner Geruch- und Staubbelastung mehr kommt.
Dieses neue System ist bereits in Köln (lateinisch coloniam) erfolgreich im Einsatz und wird nun in Wien getestet.

Weltwirtschaftskrise in den 30er-Jahren
Die Weltwirtschaftskrise macht sich zu Beginn der dreißiger Jahre verheerend bemerkbar. Hatten die vergangenen Jahre in gewisser Hinsicht Anlass zu Optimismus gegeben, so tritt nun eine Wende ein, die viele Menschen besonders hart trift, wie unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg: Arbeitslosigkeit, Hunger, Verzweiflung - nehmen vielen Leuten wieder einmal jeden Mut.
Neuer Plan zur Errichtung von Wohnhäusern
Franz Spandl entwickelt ein neues Programm zur gemeinsamen Errichtung von Wohnhäusern und erreichte gemeinsam mit seinen Kameraden Zegarczuk und Schina die Bewilligung durch das Kuratorium des Kriegerheimstättenfonds. Außerdem erhalten sie einen bescheidenen Geldbetrag, die Zuteilung von einer Million Ziegel und das Grundstück in der Größe von ca. 120.000m² für die Bebauung. Dies war die Geburtsstunde der 1. Bau-Gartensiedlungs-, gewerbliche Produktivgenossenschaft der Kriegsbeschädigten Österreichs, Gruppe Kriegerheimstätten Hirschstetten
.
Baumschule Schick
Ferdinand Schick sen. gründet die Baumschule Schick. Sie entspricht den Bedürfnissen der näheren und weiteren Umgebung.
Fleischerei Weis
Lokal 2 - grüne Hütte
Mit Fleisch und Wurstwaren versorgt Herr Robert Weis seine Kunden. Im Hinteren Teil seines Geschäftslokales
befindet sich ein kleiner begehbarer Kühlraum, der anfangs mit Blockeis, später elektrisch betrieben wird.
Tabak Verschleiß Tvrz
Lokal 7